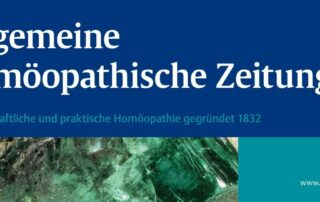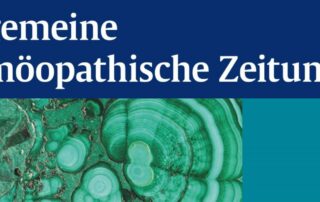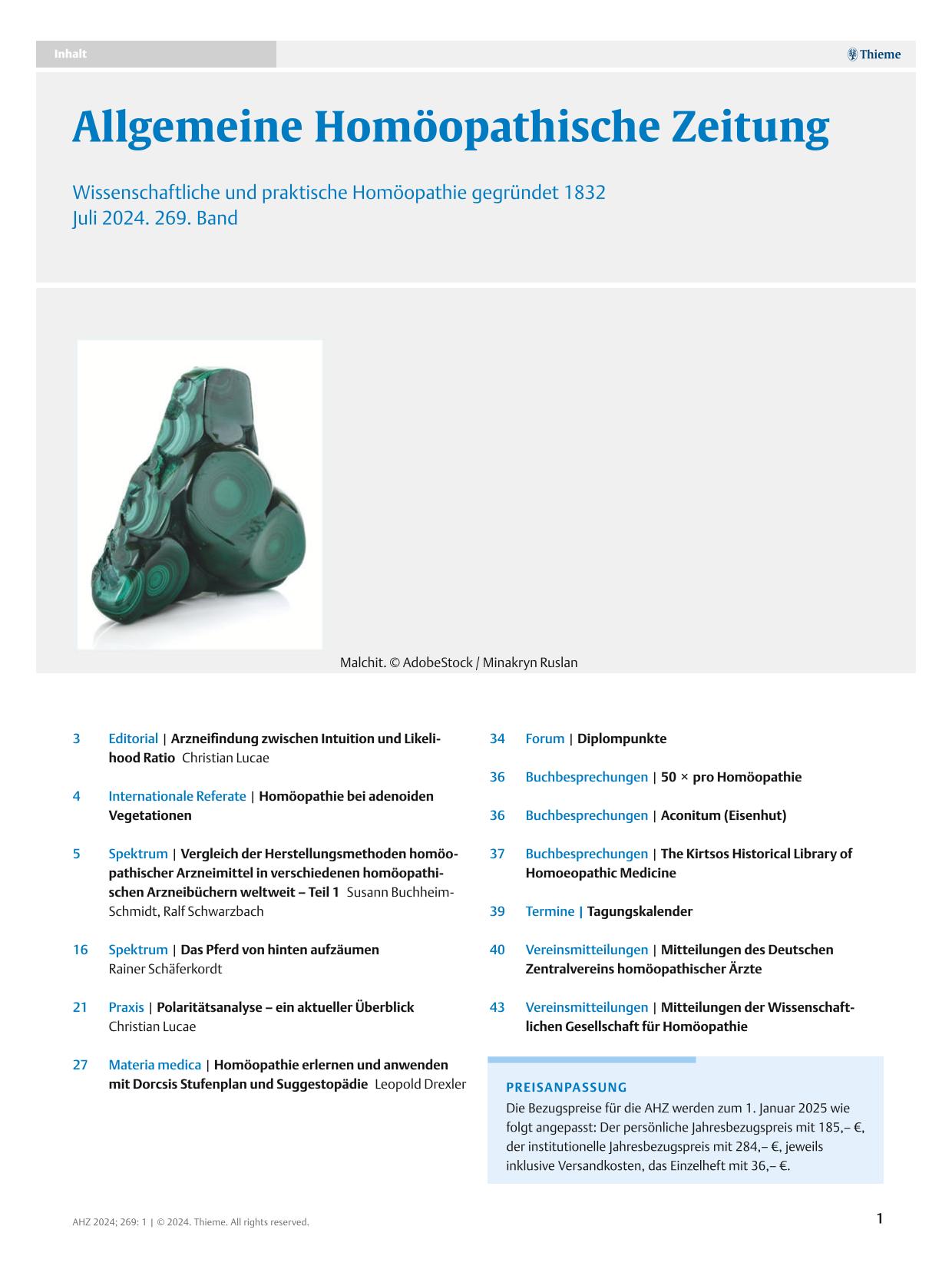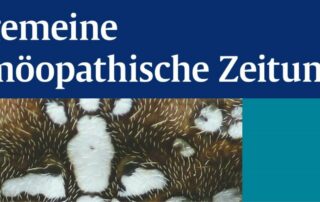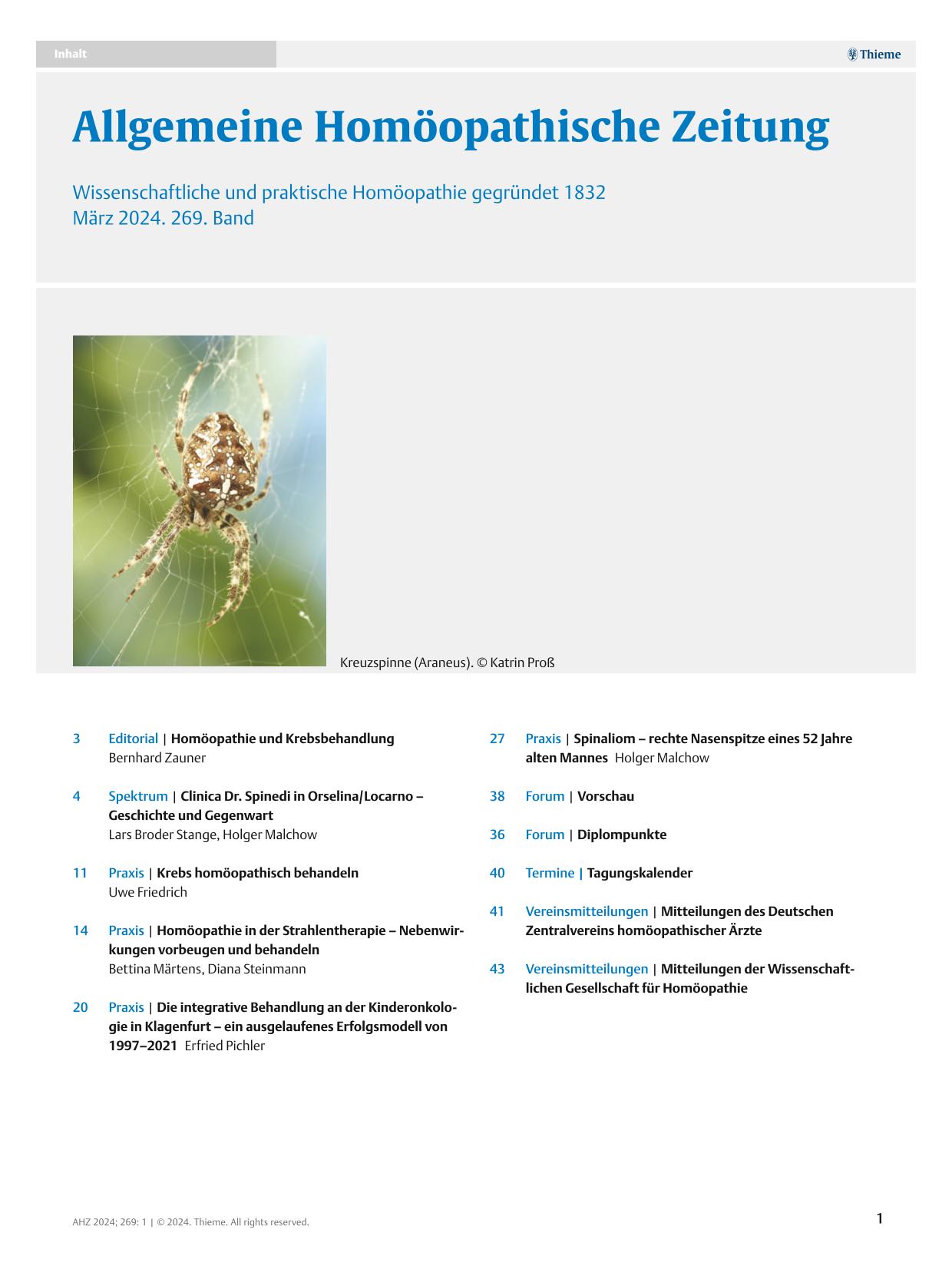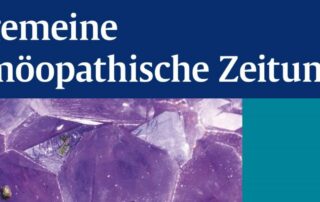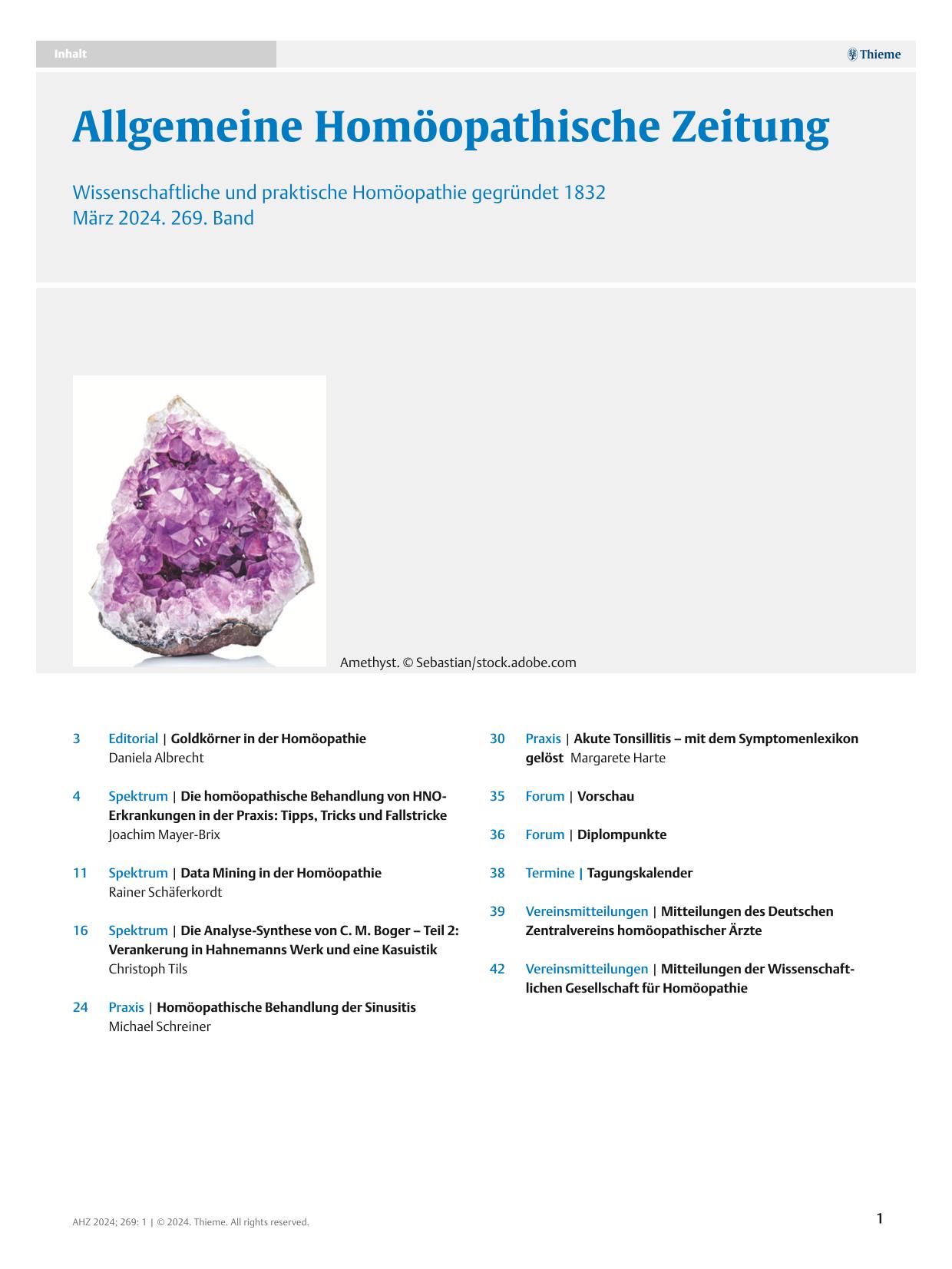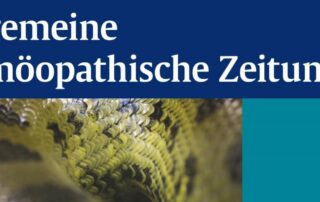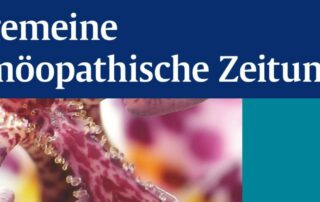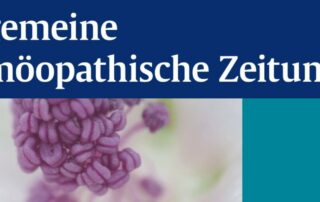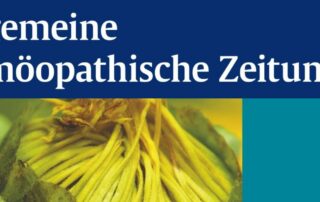AHZ 2/2025 Verifikationen
Die Allgemeine Homöopathische Zeitung (AHZ) ist die Mitgliederzeitschrift des DZVhÄ. In der zweiten Ausgabe 2025 steht das Thema „Verifikationen“ im Mittelpunkt. Lesen Sie das Editorial und die Vereinsmitteilung in voller Länge und stöbern Sie im Inhaltsverzeichnis. Mitglieder erhalten die komplette Print-Ausgabe automatisch im Rahmen ihrer Mitgliedschaft.
Editorial: Verifikationen
von Daniela Albrecht
Verifikationen in der Homöopathie
Dieses Heft beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Thema Verifikationen. Das Wort bedeutet die Richtigkeit darlegen, beweisen, beglaubigen. Es leitet sich von den lateinischen Wörtern „verus“ (wahr, wirklich) und „facere“ (tun, machen) ab. Die Richtigkeit unserer Materia medica bleibt ein immerwährendes und wichtiges Thema in der Homöopathie. Wie kommen wir aber voran?
Eine Möglichkeit ist das Verfassen einer Verifikation aufgrund von eigenen Heilerfahrungen nach Verordnung eines homöopathischen Mittels. Um dabei möglichst standardisiert vorzugehen, wurden Basiskriterien zur Verifikation festgelegt:
- Das Symptom muss eindeutig und dauerhaft, das heißt unter ausreichender Nachbeobachtungszeit verschwunden sein (bei akuten Erkrankungen mindestens 4 Wochen, bei chronischen Erkrankungen mindestens 2 Jahre).
- Es sollten möglichst charakteristische und deutlich ausgeprägte Symptome verifiziert werden.
- Es sollten nur deutlich wahrnehmbare, krankhafte Veränderungen verifiziert werden, keine Hypothesen oder Interpretationen.
- Eine Verifikation muss auf eine einzige Arznei zurückführbar sein.
- Die Verifikation sollte möglichst eindeutig auf die homöopathische Arznei und nicht auf andere Therapien zurückgeführt werden können.
- Die Verifikation sollte möglichst eindeutig auf die homöopathische Arznei und nicht auf andere Umstände (z. B. Änderung der Lebenssituation, Ausschaltung krank machender Faktoren) zurückgeführt werden können.
- Bei akuten Erkrankungen muss die Abheilung auffallend schneller erfolgen, als es für einen Spontanverlauf zu erwarten wäre.
Sicher nicht immer einfach einzuhaltende Kriterien, aber ein Standard sollte auch die höchste zu erreichende Stufe zeigen, und kleinere Abstriche müssen wir beim Arbeiten außerhalb des Reagenzglases akzeptieren. Wie gut es wirkt und hilft, sehen wir trotzdem.
Fallbeispiele und ihre Bedeutung
In diesem Heft haben verschiedene Autoren dargestellt, wie gut behandelte Fälle dazu beitragen können, unsere Materia medica sicherer zu machen, sodass wir nach der genauen Anamnese, Analyse und Repertorisation ein zuverlässiges Mittel finden.
Neben häufigeren Mitteln wie Phosphorus, Hamamelis und Argentum nitricum finden Sie im Heft auch Verifikationen und Kasuistiken zu Menyanthes, Lac defloratum, Tarentula, Laurocerasus, Kola und Muriaticum acidum. Vielleicht erfüllen nicht immer alle jeden Punkt der oben genannten Kriterien, aber sicher trägt jeder Artikel dazu bei, unsere aktuelle Praxis und den Stand der Homöopathie festzuhalten.
Darüber hinaus schauen wir mit dem Artikel zur „Quantum Logic Medicine“ auf eine besondere Art der Homöopathie, die durch Prof. Walter Köster entwickelt wurde.
Die Bedeutung des Schreibens für die Homöopathie
„Wer schreibt, der bleibt“ – ein altes Sprichwort, das oft von einigen Professoren aus meiner Universitätszeit verwendet wurde, um uns für das wissenschaftliche Arbeiten oder eine Doktorarbeit zu gewinnen. Ich empfinde es weiterhin als aktuell und zeitgemäß.
Leider wird es immer schwieriger, Autoren zu finden und Kollegen zu bewegen, ihre Erkenntnisse und Fälle zu Papier zu bringen. Dabei ist es doch eine gute Möglichkeit, etwas aus der eigenen Praxis, seinem Arbeiten und von sich zu hinterlassen. Ich würde mir wünschen, dass das Schreiben wieder populärer wird.